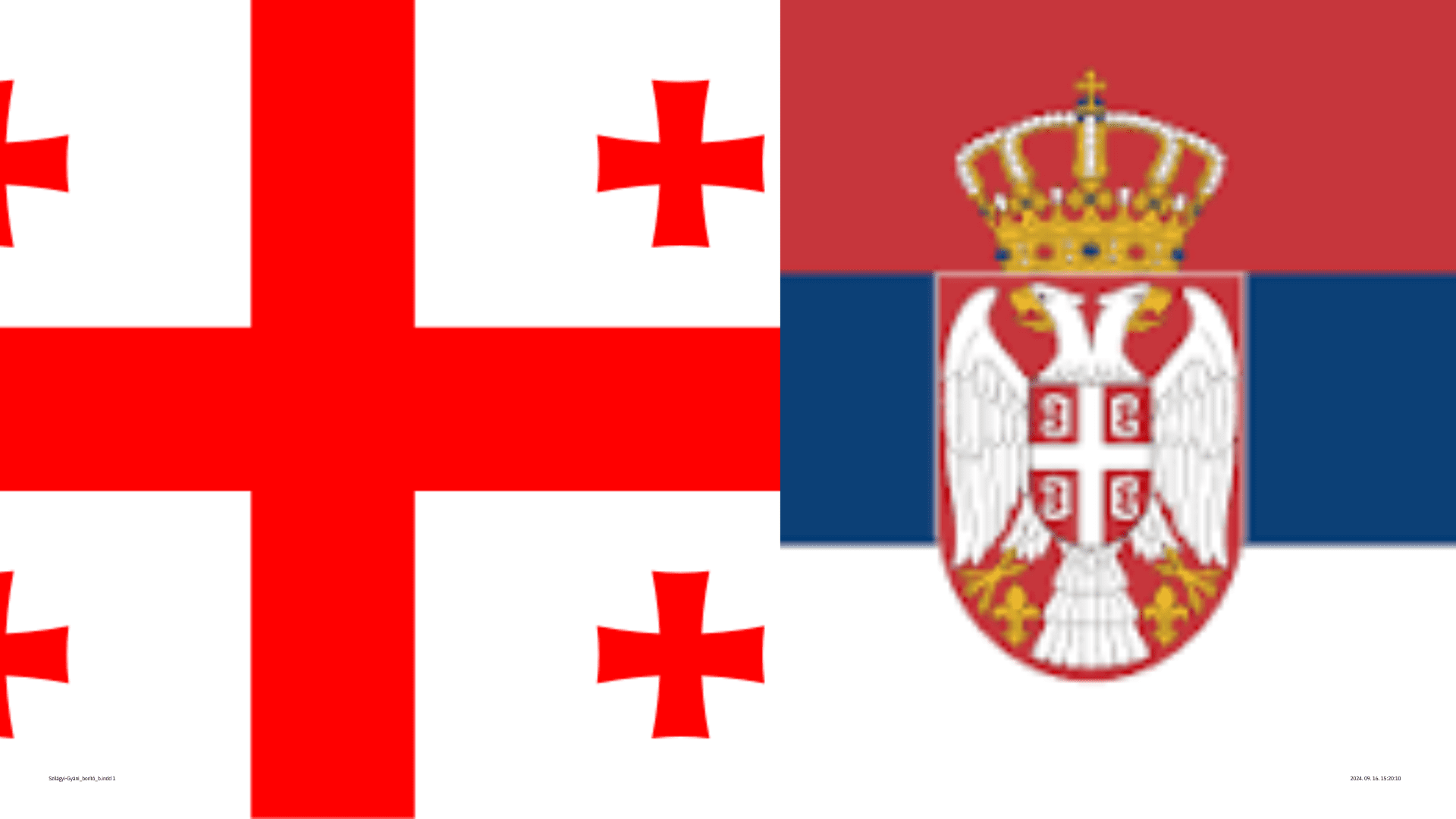Seit Monaten protestieren vor allem Studierende auf den Straßen von Belgrad und Tbilisi gegen die fortschreitende Autokratisierung ihrer Länder durch Männer, deren Macht ihr eigentliches politisches Amt weit überschreitet. Beide Staaten sind Kandidaten im EU-Erweiterungsprozess, stehen aber auch unter dem starken Einfluss Russlands, was sie zu wichtigen Schauplätzen für die Aushandlung der globalen Rolle Europas in einer neuen globalen Ordnung macht.
Hintergerund
Die aktuellen Protestwellen in beiden Ländern begannen in kurzem Abstand voneinander. In Georgien folgten sie der Verkündung der vorläufigen Wahlergebnisse am 28. Oktober 2024, in Serbien dem Einsturz des Bahnhofsvordachs in Novi Sad am 1. November 2024 mit 16 Todesopfern. Wenngleich die Teilnahmezahlen beispiellos sind, reihen sich die Bewegungen in beiden Fällen in vorherige Demonstrationen ein, die sich im Wesentlichen gegen den staatlichen Demokratieabbau richteten.
In Belgrad ist Präsident Aleksandar Vučić, ein Relikt der Milošević-Regierung in Jugoslawien, seit 2012 in verschiedenen Rollen an der Macht. Seit 2017 ist er Präsident, laut Verfassung ein hauptsächlich zeremonielles Amt ähnlich dem deutschen Bundespräsidenten. Tatsächlich hat sich Vučić durch die gezielte Schwächung der erst jungen Demokratie – Beeinflussung der Justiz, Kontrolle nahezu aller Medien, Einschüchterung unabhängiger Zivilgesellschaft – ein Gewaltmonopol aufgebaut, mit dem niemand konkurrieren kann. Außenpolitisch hält er einen erfolgreichen Balanceakt zwischen der EU, Russland und China. Der Einsturz des Vordachs ist für die Protestierenden Ausdruck der Korruption und Vetternwirtschaft, auf dem das System Vučić aufgebaut ist, und sie protestieren für Rechtsstaatlichkeit und Transparenz. Dabei verweisen sie auf die Grundsätze der serbischen Verfassung und lehnen eine Vermittlungsrolle des Präsidenten ab, dem sie auf dieser Basis die nötigen Kompetenzen absprechen. Serbien ist seit 2012 EU-Beitrittskandidat, seit 2021 gab es im Prozess keine Fortschritte mehr. Während die Regierung öffentlich stets den Beitrittswillen betont, ist die Zustimmung in der Bevölkerung von allen Beitrittsländern am schwächsten ausgeprägt.
Genau umgekehrt ist das Bild in Georgien: Schon lange bevor die EU dem Land offiziell eine Beitrittsperspektive eröffnete, herrschte in der Bevölkerung großer Enthusiasmus für diese. Nach wie vor wird an Regierungsgebäuden die georgische von der EU-Flagge flankiert, auch wenn sich die Staatsführung in den letzten Jahren in eine andere Richtung orientiert hat. Auch hier ist Macht vor allem in einer Person konzentriert: Der ehemalige Ministerpräsident und Oligarch Bidsina Iwanischwili, heute formell nur noch Ehrenvorsitzender der Regierungspartei „Georgischer Traum“. Diese war ursprünglich mit dem Versprechen der EU-Integration Georgiens an die Macht gekommen, widersetzt sich jedoch den notwendigen Reformen. Mit Methoden aus Russland und Ungarn schränkt die Regierung seit Jahren systematisch freie Presse und Zivilgesellschaft ein. Wendepunkt war das „Gesetz zur Transparenz ausländischer Einflussnahme“, besser bekannt als „Gesetz zu ausländischen Agenten“ nach Vorbild Moskaus, das seit Juni 2024 in Kraft ist und seither noch verschärft wurde. Es führte direkt zum Abbruch der EU-Verhandlungen, außerdem wurden EU-Gelder für das Land eingefroren, und mehrere Mitgliedsstaaten verhängten Sanktionen gegen führende Mitglieder der Regierung. Durch das Gesetz wird die Arbeit unabhängiger zivilgesellschaftlicher Organisationen fast unmöglich, zumal die unklare Formulierung und befangene Justiz viel Platz für Willkür lassen. Viele EU-Staaten erkennen die die Regierung nicht an, nur Ungarn pflegt gute Beziehungen zu ihr.
Welche Rolle spielt Russland?
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist eine Zäsur für die politische Ausrichtung beider Länder. Die serbische Regierung hat sich trotz Drucks der EU-Staaten den Sanktionen gegen Russland nicht angeschlossen und noch im Mai 2022 neue Gasverträge mit Moskau vereinbart. Belgrad ist Standort in der EU verbotener pro-russischer Medien wie „Russia Today“, und auch regierungsnahe serbische Medien verbreiten pro-russische Narrative und titelten am 22. Februar 2022 „Die Ukraine greift Russland an“. Entsprechend hoch ist die Unterstützung für die russische Regierung unter der serbischen Bevölkerung, gestärkt durch ein Narrativ „slawischer Bruderschaft“ zwischen den Staaten und der Unterstützung des Kremls gegen Kosovos Unabhängigkeit, etwa im UN-Sicherheitsrat. Serbien ist neben der Türkei das einzige europäische Land, das noch Direktflüge nach Russland durchführt. Besonders Belgrad beherbergt eine große Anzahl russischer Auswanderer, die vor Krieg bzw. Rekrutierung flohen, was angesichts steigender Mietpreise teils zum Unmut der lokalen Bevölkerung führt, die grundsätzlich pro-russische Haltung aber kaum beeinträchtigt. Auf der anderen Seite erfahren russische Kriegsgegner:innen in Belgrad Repressionen, viele von ihnen ziehen weiter.
Auch in Georgien ist eine große russische Diaspora beheimatet, wie auch viele Ukrainer:innen. Das Nachbarland war Teil der Sowjetunion und viele Menschen sprechen Russisch, Georgien war auch vor dem Krieg ein beliebter Urlaubsort für Russ:innen. Angesichts des Krieges mit Russland im Jahr 2008 und der weiterhin mit russischer Unterstützung besetzten Gebiete Südossetien und Abchasien ist die Haltung vieler Georgier:innen gegenüber Russland jedoch äußerst negativ, verstärkt durch die Preissteigerungen als Folge der Masseneinwanderung und der Angst, ein ähnliches Schicksal wie die Ukraine zu erleiden. Die Regierung nutzt diese Angst für ihr Narrativ, der „Westen“ wolle in Georgien eine „zweite Front“ eröffnen. Sie hat die Abhängigkeit von russischem Gas seit dem russischen Angriffskrieg noch erhöht und ist eine wichtige Unterstützerin Russlands in der Umgehung von Sanktionen.
Der Trump-Effekt
Die erneute Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten hatte ebenfalls direkte wie indirekte Auswirkungen auf die Ausrichtungen beider Regierungen. Seine antidemokratische Politik und transaktionale Außenpolitik lassen den lokalen Autokraten mehr Spielraum, um etwa durch Investitionen wie dem geplanten „Trump Tower“ in Belgrad das Wohlwollen des Präsidenten zu gewinnen. Der Rückzug der USA als Demokratisierungsmacht, besonders durch das Aussetzen von Hilfsgeldern wie USAID, bedroht die Existenz der ohnehin geschwächten lokalen Zivilgesellschaft. Zugleich nutzen die Regierungen in Belgrad und Tbilisi den Backlash Washingtons gegen diese Initiativen, um demokratische Institutionen und Organisationen im eigenen Land zu verunglimpfen und einzuschüchtern. So wurden in Belgrad im Februar die Büros mehrerer Nichtregierungsorganisationen durchsucht, die zuvor USAID-Finanzierung erhalten hatten, auf Basis der Äußerungen Trumps, USAID habe Gelder veruntreut. Der georgische Ministerpräsident Irakli Kobakhidze, dessen Regierung in Europa zunehmend isoliert dasteht, richtete im Mai einen offenen Brief an Trump, von dem er sich eine vertiefte Partnerschaft und Unterstützung erhofft und sich dessen Aussagen zu USAID und anderen vermeintlichen Vertretern eines „Schattenstaates“ (Deep State) anschließt, den er auch für die anhaltenden Proteste verantwortlich macht. Eine Antwort des Präsidenten steht noch aus.
Realitätstest für die EU
Angesichts der zunehmend instabilen globalen Ordnung steht die EU vor einem Dilemma im Umgang mit den antidemokratischen und pro-russischen Kräften in ihrer Nachbarschaft. Ein gewaltsamer Regierungsumsturz und damit einhergehendes Chaos sollen unbedingt vermieden werden. Serbien hat großen Einfluss in den anderen Ländern des sogenannten „Westbalkans“, was die Regierung bereits in der Vergangenheit genutzt hat, um durch Eskalation andernorts von innenpolitischen Spannungen abzulenken. Viele EU-Staaten unterhalten wichtige Wirtschaftsbeziehungen zu dem größten Land der Region und sehen in der Regierung trotz autokratischer Tendenzen weiterhin einen verlässlichen Partner. Georgien, wenngleich deutlich direkter aus Brüssel kritisiert, ist Teil strategischer Initiativen der EU im Rahmen des „Global Gateway“-Projekts, mit dem die Union ihre globale Handelsmacht festigen will. Dazu gehören der Ausbau des „Mittelkorridors“ als alternative Handelsroute zu Russland und die neue Schwarzmeer-Strategie, die im Mai vorgestellt wurde. Nicht zuletzt stößt die wertegeleitete Außenpolitik in Zeiten globaler Autokratisierung zunehmend an ihre Grenzen.
Gleichzeitig sind beide Länder EU-Beitrittskandidaten und richten sich die Protestierenden direkt an die Institutionen und Werte der EU. Ihre Forderungen reichen von Sanktionen bis zum Druck auf die Regierung für demokratische Neuwahlen. Zwar finden sich in Belgrad anders als in Tbilisi bei den Protesten keine EU-Flaggen, dafür haben die Studierenden spektakuläre Protestaktionen wie eine Fahrradtour zum EU-Parlament in Strasburg und einen Marathon nach Brüssel organisiert, um Unterstützung zu gewinnen. Tatsächlich hat sich das Europaparlament den Forderungen in der Mehrheit angeschlossen und auch die Kommission und den Rat zu entschlossenem Handeln aufgefordert. Kommissionsvertreterinnen von der Präsidentin Ursula von der Leyen über die Außenbeauftrage Kaja Kallas bis hin zur Erweiterungskommissarin Marta Kos haben das Vorgehen in Georgien deutlich verurteilt, ihre Kritik an Serbien dagegen ist eher verhalten; von der Leyen lobte den serbischen Präsidenten Anfang des Jahres sogar für vermeintliche Fortschritte bei demokratischen Standards. Im Rat der EU wissen sich die Regierungen durch das ungarische (und slowakische) Veto vor EU-Sanktionen geschützt, die im Falle Serbiens ohnehin derzeit keine Mehrheit fänden.
Schlussendlich geht es um die Glaubwürdigkeit der EU als globaler Akteur, wobei seit jeher die Nachbarschaft erste Front ist. Offenbar reichen die Anreize des Erweiterungsprozesses nicht aus, um eine Annäherung an die EU bei gleichzeitiger Abkehr von Russland herbeizuführen. Welche Strategien die Union für beide Länder entwickelt und ob sie erfolgreich sind, ist ein wichtiger Realitätscheck für die EU als Ordnungsmacht – intern, regional und global.
Frauke SEEBASS
Frauke Seebass ist Doktorandin im Teilprogramm Politikwissenschaften an der Andrássy Universität Budapest und Associate Fellow bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) Berlin. Sie erhielt im Zeitraum von November 2024 – September 2025 ein Carl-Lutz Stipendium im Rahmen des Projekts „ Changing Orders Research Programme “, unterstützt durch den Schweizer Beitrag mit der nationalen Kofinanzierung der ungarischen Regierung. Sie ist Gastwissenschaftlerin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Brüssel und arbeitet zur EU-Erweiterungspolitik mit einem Schwerpunkt auf dem Westbalkan.“
Endnoten
Cvijic, Srdjan, and Kristina Nikolic. „NON-MALIGN INFLUENCE: WHAT DOES THE RUSSIAN COMMUNITY IN SERBIA THINK AND DO?.“ (2025).
Ejdus, Filip. The (geo) politics of democracy in Serbia. European University Institute, 2025.
Grimm, Sonja, and Karin Göldner-Ebenthal. „Förderung der Demokratie in der europäischen Nachbarschaft: Analyse der verhaltensbedingten, institutionellen und strukturellen Blockaden.“ integration 48.1 (2025): 51-65.
Panchulidze, Elene, and Richard Youngs. „The Source of Georgia’s Democratic Resilience.“ Journal of Democracy 36.1 (2025): 123-134.